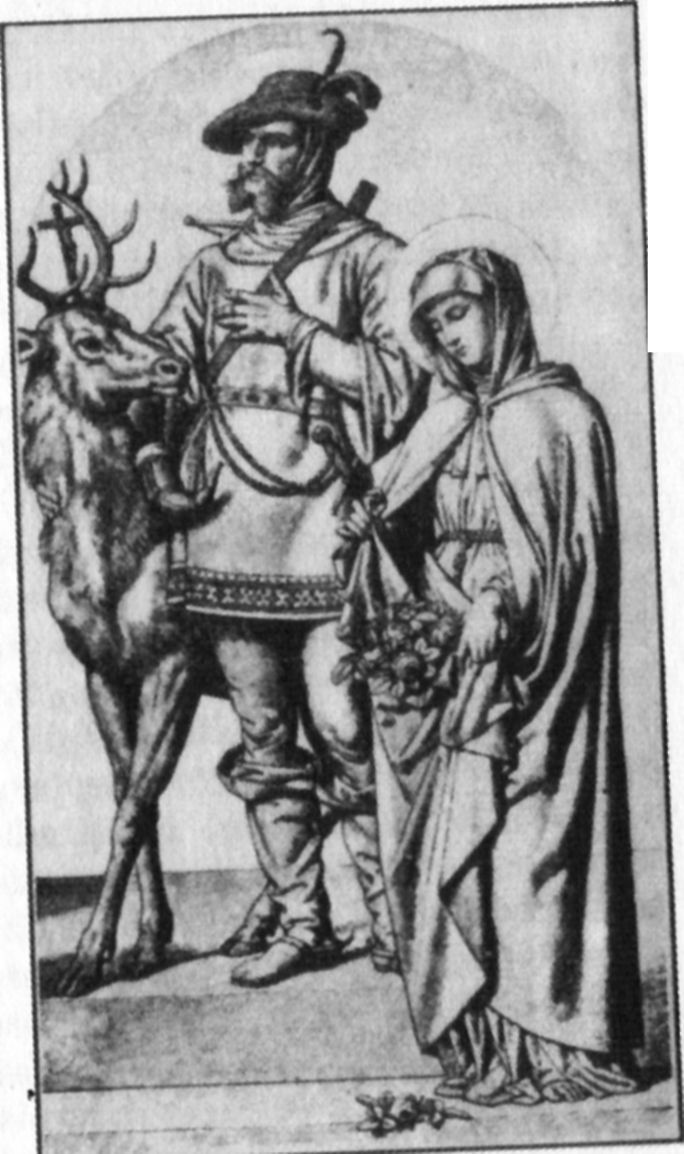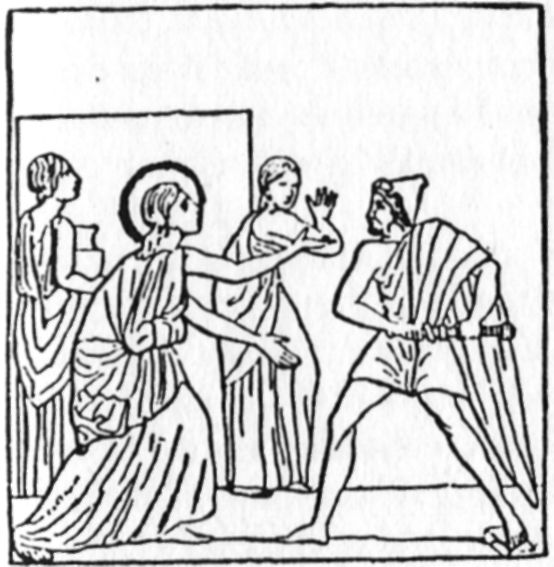Kath. Mysterienkult
Heilige, Heiligentage (Namenstage) und Heiligensymbole Ralph Woodrow: "Die römische Kirche - Mysterienreligon aus Babylon", Verlag 7000, 1. Aufl. 1992, Kap. 35-42
Inhaltsübersicht:
- Wer sind die Heiligen? - Sollen wir zu ihnen beten?
- Heiligenverehrung - eine Fortsetzung der Vielgötterei
- Götzenbilder, Statuen und Bilder als Gegenstand der Anbetung
- Der Heiligenschein um den Kopf Heiliger
Zusätzlich zu den Gebeten und Ehrerbietungen, die an die »Maria« gerichtet sind, verehren und beten Katholiken auch verschiedene »Heilige« an. Nach dem katholischen Standpunkt sind diese Heiligen Märtyrer oder andere beachtenswerte Glieder der Kirche, die gestorben sind, und die der Papst heilig gesprochen hat.
Wer sind die Heiligen? - Sollen wir zu ihnen beten?
Heiligenlexikon - Heiligenbiografien
Viele meinen, daß das Wort »Heiliger« sich ausschließlich auf Personen bezieht, die einen besonderen Grad an Heiligkeit erreicht haben, also nur auf einzigartige Nachfolger Christi.
Gemäß der Bibel sind ALLE wahren Christen Heilige, selbst diejenigen, denen leider geistliche Reife und Erkenntnis fehlen. Daher sind die Schreiben des Paulus, die für Christen in Ephesus, Philippi, Korinth oder Rom bestimmt waren, an »die Heiligen« gerichtet (Eph.1,1 u.a.).
Beachten Sie bitte, daß das Neue Testament lebende Menschen als Heilige bezeichnete und nicht bereits gestorbene.
Wenn wir möchten, daß ein »Heiliger« für uns betet, muß dieser eine lebende Person sein. Versuchen wir jedoch mit Leuten, die schon tot sind, Gemeinschaft zu haben, dann ist dies nichts anderes als eine Art des Spiritismus! Die Bibel verurteilt wiederholt alle Versuche, mit den Toten Gemeinschaft zu haben (siehe Jes.8,19.20).
Dennoch zitieren viele das »Apostolische Glaubensbekenntnis«: »Wir glauben... an die Gemeinschaft der Heiligen«, und sie nehmen dabei an, daß dies den Gedanken des Gebetes für und zu den Toten beinhaltet.
Dazu schreibt die »Katholische Enzyklopädie« folgendes: »Was Gebete für die Toten anbelangt, ist die katholische Lehre untrennbar mit dem Dogma von der Gemeinschaft der Heiligen, das ein Teil des Apostolischen Glaubensbekenntnisses ist, verbunden.« Es werden Gebete »zu den Heiligen und Märtyrern insgesamt oder zu einigen von ihnen im besonderen« empfohlen.1
Die tatsächliche Formulierung des Konzils von Trient lautet folgendermaßen: »Die Heiligen, die zusammen mit Christus regieren, bringen ihre eigenen Gebete für die Menschen vor Gott dar. Es ist gut und nützlich, sie flehentlich anzurufen, um durch ihre Gebete von ihnen Unterstützung, Hilfe und Schutz zu erfahren, um darüberhinaus Gottes Gunst zu bekommen«.2
Was sind die Einwände gegen diese Überzeugungen? Lassen wir die Frage von der Katholischen Enzyklopädie selbst beantworten. »Der wichtigste Einwand gegen die Fürbitten und Invokationen, die an die Heiligen gerichtet sind, ist derjenige, daß diese Lehren dem Glauben und dem Vertrauen, das wir in Gott allein haben sollen, entgegenstehen . . . und, daß sie nicht von der Bibel her bewiesen werden können . . .«'
Dieser Aussage stimmen wir zu. Nirgends gibt es in der Heiligen Schrift Anzeichen dafür, daß die Lebenden durch Gebete zu Toten oder durch Gebete dieser Toten gesegnet, beziehungsweise bevorzugt werden können. Statt dessen ist die Betrachtungsweise der »katholischen Lehre der Heiligen« den alten heidnischen Vorstellungen über die »Götter« sehr ähnlich.
Heiligenverehrung - eine Fortsetzung der Vielgötterei Wenn wir uns wieder der »Mutter« der falschen Religion - Babylon - zuwenden, stellen wir fest, daß die Menschen zu einer Vielzahl von Göttern gebetet und diese verehrt haben. Tatsächlich entwickelte sich das babylonische System dahin, daß es etwa 5.000 Götter und Göttinnen vorweisen konnte.4
So wie die Katholiken von ihren »Heiligen«, so glaubten auch die Babylonier, daß ihre »Götter« einst lebende Helden auf der Erde waren, aber sich jetzt auf einer höheren Ebene befinden. 5
»Jeder Monat und jeder Tag des Monats stand unter dem Schutz einer besonderen Gottheit.« 6
Es gab für jedes Problem einen Gott, sowie für jeden Beruf und für jede Lebenslage.
Von Babylon aus verbreiteten sich solche Konzepte von den »Göttern« unter den Nationen, wie auch die Anbetung der Großen Mutter.
Selbst die Buddhisten in China hatten ihre »Anbetung von verschiedenen Gottheiten, wie die der Göttin der Seeleute, des Kriegsgottes, der Götter für spezielle Nachbarschaften oder Berufe.«7
Die Syrer glaubten, daß die Kräfte bestimmter Götter auf bestimmte Gebiete begrenzt waren, wie ein Ereignis in der Bibel berichtet: »Ihre Götter sind Berggötter, darum waren sie uns überlegen; jedoch laßt uns in der Ebene mit ihnen kämpfen, ob wir ihnen nicht überlegen sein werden« (1.Kön.20,23).
Als Rom die Welt eroberte, waren genau diese Gedanken und Vorstellungen zu finden, wie die folgende Skizze zeigt. Brighit war die Göttin der Schmiede und der Dichtkunst. Juno Regina war die Göttin der Frauen und der Ehe. Minerva war die Göttin der Weisheit, der Kunsthandwerker und der Musiker. Venus war die Göttin der sexuellen Liebe und der Geburt. Vesta war die Göttin der Bäcker und der heiligen Feuer. Ops war die Göttin des Reichtums. Ceres war die Göttin des Getreides, des Weizens und aller Vegetation. Das englische Wort »cereal« = Getreide stammt von ihrem Namen. Bacchus war der Gott der Freude und des Weines. Merkur war der Gott der Redner und kam in den alten Fabeln selbst als Redner vor. Das erklärt auch die Tatsache, daß die Einwohner von Lystra glaubten, Paulus sei der Gott Merkur (griech. Hermes, Anm. Übers.) (Apg. 14,11.12). Die Götter Castor und Pollux waren die Beschützer Roms und die der Seereisenden (Apg.28,11). Cronus war der Wächter über Eide. Janus war der Gott der Türen und Tore. »Es gab Götter, die leiteten jeden Augenblick des Lebens. Da waren die Götter des Hauses und des Gartens, des Essens und Trinkens, der Gesundheit und der Krankheit.« 8
Die Vorstellungen, verschiedene Ereignisse des Lebens mit Göttern und Göttinnen zu assoziieren, was nun im heidnischen Rom seinen festen Platz hatte, bedurfte nur eines weiteren Schrittes, bis sie schließlich auf die Kirche von Rom übergriff. Da etliche aus dem Heidentum Bekehrte sich weigerten, sich von ihren »Göttern« zu trennen - es sei denn, sie konnten einen befriedigenden Ersatz dafür im Christentum finden - wurden die Götter und Göttinnen umbenannt und zu »Heiligen« gemacht.
Der alte Gedanke, bestimmte Berufe und Tage mit Göttern zu verknüpfen, wird in der Römisch-Katholischen Kirche im Glauben an die Heiligen und an Heiligentage fortgeführt, wie es auf vielen Kalendern mit den sogenannten »Namenstagen« angezeigt ist. Jeder Tag des Jahres ist einem Heiligen geweiht und es gibt Verzeichnisse, welcher Heiliger der besondere Schutzpatron für den jeweiligen Beruf ist, z.B. St. Barbara der Bergleute.
Bei bestimmten Krankheiten und Problemen soll man jeweils den zuständigen Heiligen anrufen, z.B. bei Augenkrankheiten St.Lucia, um Kinder zu bekommen St.Felicitas, bei Feuer St. Laurentius, u.s.w.
St. Hubert wurde etwa im Jahre 656 geboren und er erscheint in unserer Liste als Schutzpatron der Jäger und als Heiler der Tollwut. Vor seiner Bekehrung verbrachte er den größten Teil seiner Tage mit der Jagd. Nach der Legende verfolgte er an einem Karfreitagmorgen einen großen Hirsch, der sich plötzlich umwandte. Er »sah« ein Kreuz zwischen dessen Geweih und hörte eine Stimme, die ihm sagte, er solle sich zu Gott bekehren.
St. Hubertus, Patron der Jäger mit St. Elisabeth Aber warum zu »Heiligen« beten, wenn man doch als Christ Zugang zu Gott hat?
Die Katholiken werden gelehrt, daß sie durch Gebete zu »Heiligen« Hilfe erlangen könnten, die Gott möglicherweise sonst nicht geben würde! Sie werden gelehrt, Gott zu verehren und dann zu »beten, erst zu der heiligen Maria, den heiligen Aposteln, den heiligen Märtyrern und allen Heiligen Gottes ... sie als Freunde und Beschützer zu betrachten und ihre Hilfe in der Stunde der Bedrängnis zu erflehen in der Hoffnung, daß Gott dem Patron gewähren wird, was er dem Bittenden sonst eventuell verweigern würde«/'
Alles zusammengenommen macht deutlich, daß das Römisch-Katholische System der Schutzheiligen entstanden ist aus dem alten Glauben an Götter, denen Tage, Berufe, sowie alle Lagen des Lebens geweiht waren.
Viele der alten, mit den heidnischen Göttern assoziierten Legenden wurden auf die Heiligen übertragen. Sogar die Katholische Enzyklopädie schreibt, daß diese »Legenden die Vorstellungen, die in den vor-christlichen religiösen Erzählungen gefunden wurden, wiederholen. . . die Legende ist nicht christlich, nur christianisiert. . . in vielen Fällen hat sie offensichtlich den gleichen Ursprung wie der Mythos. . . die Antike verfolgte Quellen, deren natürliche Elemente sie nicht verstand, zurück bis zu den Helden; dies war auch der Fall mit vielen Heiligen-Legenden. . . So war es nun nicht mehr schwierig, die Vorstellungen, die die Menschen der Antike über ihre Helden hatten, auf die Märtyrer des Christentums zu übertragen. Diese Übertragung wurde auch von den zahlreichen Fällen unterstützt, in denen christliche Heilige die Nachfolger der lokalen Gottheiten wurden, und die christliche Anbetung die uralte ortsansässige Religion ersetzte. Dies erklärt die große Anzahl von Ähnlichkeiten zwischen Göttern und Heiligen.« 10
Als Heidentum und Christentum vermischt wurden, erhielt manchmal ein Heiliger einen ähnlich klingenden Namen wie der heidnische Gott oder die Göttin, den oder die er ersetzte. Die Göttin Viktoria, die im französischen Alpenvorland angebetet wurde, heißt nun St. Victoire, Cheron wurde in St. Ceranos umbenannt, Artemis wurde zu St. Artemidos, Dionysus zu St. Dionysus usw. Die Göttin Brighit, die als die Tochter des Sonnengottes angesehen und die mit einem Kind in ihren Armen dargestellt wurde, wurde einfach zur »Heiligen Brigitte« umbenannt.
In heidnischen Zeiten dienten in ihrem Haupttempel bei Kildare auf Irland Vestalinnen, die die heiligen Feuer hüteten. Später wurde ihr Tempel ein Kloster und ihre Vestalinnen Nonnen. Sie fuhren fort, das rituelle Feuer zu hüten, nur wurde es nun »das Feuer der heiligen Brigitte« genannt."

Der besterhaltene antike Tempel von Rom ist das Pantheon. Früher war es »Jove (Jupiter) und allen Göttern« gewidmet, gemäß der Inschrift über dem Portikus. Papst Bonifatius IV weihte das Pantheon der Jungfrau Maria und allen Heiligen. Eine solche Art der Vorgehensweise war nicht ungewöhnlich. »Es wurden des öfteren Kirchen oder Ruinen von Kirchen an Plätzen gefunden, wo ursprünglich heidnische Heiligtümer oder Tempel standen. . . Es kam auch vor, daß der Heilige, dessen Hilfe an einem christlichen Heiligtum erbeten wurde, äußerliche Analogien zu der Gottheit aufwies, die vorher an diesem Platz verehrt wurde. So geschah es in Athen mit dem Heiligtum des Heilers Asklepios . . . Als es eine Kirche wurde, weihte man sie zwei Heiligen, die die christlichen Athener als Wunderheiler anriefen, Kosmas und Damian.« 12
Eine Höhle, die in Bethlehem als Geburtsstätte Jesu ausgegeben wird, war, wie Hieronymus berichtet, in Wirklichkeit ein Felsenheiligtum, wo der babylonische Gott Tammuz angebetet wurde. In der Schrift ist nirgends zu lesen, daß Jesus in einer Höhle geboren wurde.
Götzenbilder, Statuen und Bilder als Gegenstand der Anbetung Im ganzen römischen Reich »starb« das Heidentum auf die gleiche Weise, nur um innerhalb der Römisch-Katholischen Kirche weiter aufleben zu können. Nicht nur die Hingabe an die alten Götter ging weiter (in einer neuen Form), sondern auch der Gebrauch der Statuen dieser Götter. Es wird gesagt, daß in einigen Fällen genau die gleichen Statuen, die als heidnische Götter angebetet worden waren, in christliche Heilige umbenannt wurden. Durch die Jahrhunderte hindurch wurden immer mehr Statuen geschaffen. Heute gibt es Kirchen in Europa, in denen zwei-, drei- oder viertausend Statuen zu finden sind."
In großen eindrucksvollen Kathedralen, in kleinen Kapellen, in Heiligtümern am Wegrand, an Armaturenbrettern von Autos; überall dort können die Götzenbilder des Katholizismus in Hülle und Fülle gefunden werden.
Der Gebrauch dieser Götzenbilder innerhalb der Römisch-Katholischen Kirche liefert einen weiteren Anhaltspunkt, um das Geheimnis des modernen Babylon aufzudecken; denn, wie Herodot erwähnte, Babylon war die Quelle, aus der aller Götzendienst zu den Nationen floß. Das Wort »Götze« mit Statuen der Maria und den Heiligen zu verbinden, mag manchem hart erscheinen. Aber ist das wirklich falsch?
In katholischen Schriften wird zugegeben, daß viele Male von verschiedenen Menschen Bilder von Heiligen in abergläubischer Weise angebetet wurden. Solche Mißbräuche werden jedoch üblicherweise der Vergangenheit zugeschrieben. Es wird erklärt, daß in dieser aufgeklärten Zeit keine gebildete Person tatsächlich das Objekt selbst anbeten würde, sondern das, was das Objekt repräsentiert. Das ist generell wahr. Aber gilt das nicht auch für heidnische Stämme, die Götzenbilder (unmißverständlich: Götzen) verwenden, um Dämonen-Götter anzubeten? Die meisten von ihnen glauben nicht, daß das Götzenbild selbst ein Gott sei, sondern, daß es nur den Dämonen-Gott darstellt, den sie verehren.
Einige Artikel der Katholischen Enzyklopädie versuchen zu erklären, daß es nichts gegen den Gebrauch von Bildern einzuwenden gäbe, wenn man die Grundlage im Auge behält, daß sie Christus oder die Heiligen verkörpern. »Die Ehre, die den Bildern erwiesen wird, bezieht sich auf die Objekte, die sie repräsentieren, so daß wir durch das Küssen der Bilder und das Enthüllen unserer Häupter und das Niederknien vor ihnen, Christus anbeten und die Heiligen verehren, dessen Abbild sie sind.«14
Nicht alle Christen sind jedoch davon überzeugt, daß diese »Erklärung« Grund genug dafür ist, Verse wie 2.Mo. 20,4.5 zu übergehen: »Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen.«
Im Alten Testament durften die Israeliten, wenn sie eine heidnische Stadt oder ein Land erobert hatten, deren Götzen nicht in ihre Religion aufnehmen. Diese mußten zerstört werden, selbst dann, wenn sie mit Silber und Gold überzogen waren!
»Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst; denn ein Greuel für den HERRN, deinen Gott es ist.« (5.Mo.7,25).
Sie mußten auch alle ihre Bilder von heidnischen Göttern zerstören (4.Mo.33:52).
Bis zu welchem Ausmaß diese Anweisungen unter dem Neuen Testament durchgeführt werden mußten, wurde durch die Jahrhunderte hindurch oft diskutiert. Die »Katholische Enzyklopädie« liefert darüber eine historische Skizze. Sie zeigt, wie besonders im 8. Jahrhundert Menschen gekämpft haben und sogar gestorben sind wegen dieser Streitfrage. Obwohl die Enzyklopädie den Gebrauch von Statuen und Bildern unterstützt, schreibt sie: »Es scheint über viele Jahrhunderte unter bestimmten Christen eine Abneigung gegen heilige Bilder gegeben zu haben; einen Argwohn, daß deren Gebrauch Götzendienst sei oder werden könnte.« 15
Sie erwähnt auch einige katholische Bischöfe, die der gleichen Meinung waren. Dennoch ist es zweifellos gegen die Lehre Christi, wenn sich Menschen - ganz gleich, auf welcher Seite sie standen - bekämpfen und töten wegen dieser Angelegenheit.
Der Heiligenschein um den Kopf Heiliger
Die Heiden machten einen Kreis oder eine Aureole um den Kopf derer, die auf ihren Bildern »Götter« darstellten. Dieser Brauch setzte sich geradewegs in der Kunst der Römischen Kirche fort. Die Illustration, die nebenan abgebildet ist zeigt, wie der Heilige Augustin in katholischen Büchern dargestellt wird - mit einer kreisförmigen Scheibe um seinen Kopf. Alle katholischen Heiligen werden auf diese Weise dargestellt.
St. Augustin mit Heiligenschein

Die Künstler und Bildhauer des alten Babylon brachten die Scheibe oder Aureole bei denjenigen an, die sie als Götter oder Göttinnen darstellen wollten. 16
Um jedoch feststellen zu können, daß dieser Brauch dem Heidentum entliehen ist, brauchen wir nur die Zeichnung von Buddha zu betrachten, der ebenfalls mit dem kreisförmigen Symbol um seinen Kopf dargestellt ist!
Die Römer stellten Kirke, die Zauberin und Tochter des Helios, des Gottes der Sonne, mit einem Kreis, der ihren Kopf einrahmt, dar.
Dieselbe Symbolik wanderte vom heidnischen Rom in das päpstliche Rom und wurde bis zum heutigen Tag beibehalten, wofür tausende von Bildern der Maria und der »Heiligen« den Beweis liefern.
Bilder, die angeblich Christus darstellen sollten, wurden mit »goldenen Strahlen«, die seinen Kopf umrahmten, gemalt. Genau auf diese Art und Weise wurde der Sonnengott der Heiden über Jahrhunderte hinweg dargestellt.
Zauberin Kirke
s. Wikipedia-Artikel über Heiligenschein
Die Kirche der ersten vier Jahrhunderte gebrauchte keine Bilder von Christus. Die Schrift gibt uns keinerlei Beschreibung über die körperlichen Merkmale Jesu, nach denen ein akkurates Gemälde von ihm hätte geschaffen werden können. Demzufolge scheint es offensichtlich der Fall gewesen zu sein, daß die Bilder von Christus, wie auch die der Maria und der Heiligen, der Vorstellungskraft von Künstlern entsprungen sind.
Wir müssen nur kurz Einblick halten in die religiöse Kunst, um zu sehen, daß in verschiedenen Jahrhunderten und bei unterschiedlichen Nationen viele Christus-Bilder - manche unterscheiden sich sehr voneinander - gefunden werden.
Offensichtlich können Ihn nicht alle so beschreiben wie Er ausgesehen hat. Darüber hinaus kennen wir Ihn nicht mehr »nach dem Fleisch« (2.Kor.5,16), da Er nun in die Himmel aufgefahren ist. Dem besten Künstler der Welt wurde es nicht gelingen, den König in Seiner Schönheit darzustellen Ihn der „verherrlicht« (Joh.7:39) und mit einem »Leib der Herrlichkeit« (Phil.3,21) versehen wurde. Kein Bild, auch nicht das Perfekteste kann darstellen, wie wunderbar Er in Wirklichkeit ist!
Anmerkungen:
1. The Catholic Encyclopedia, Bd. 4, S. 653, 655, Art.«Prayers for the de-
ad«
2. The Catholic Encyclopedia, Bd. 8, S. 70, Art.«Intercession«
3. The Catholic Encyclopedia, Bd. 8, S. 70, Art.«Intercession«
4. Hays, In the Beginnings, S. 65
5. Encyclopedia of Religions, Bd. 2, S. 78
6. Williams, The Historians' History of the World, Bd. 1, S. 518
7. Dobbins, Story of the World's Worship, S. 621
8. Durant, The Story of Civilization: Caesar and Christ, S. 61-63
9. The Catholic Encyclopedia, Bd. 4, S. 173, Art. »Communion of the
Saints«
10. The Catholic Encyclopedia, Bd. 9, S. 130-131, Art. »Legends«
11. Urlin, Festivals, Holy Days, and Saints'Days, S. 26
12. The Catholic Encyclopedia Bd. 2, S. 44, Art. »Athens«
13. Hasting's Encyclopedia of Religion and Ethics, Art. »Images and Idols«
14. The Catholic Encyclopedia Bd. 7. S. 636, Art. »Idolatry«
15. The Catholic Encyclopedia Bd. 7., S. 620 Art. »Iconoclasm«
16. Inman, Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism, S. 35
Kath. Mysterienkult